-
Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona-Politik, Diskurs, Identität und Individualismus, Kunst, Moderne, Moral, Politik, Psyche, Religion, Theorien der Kultur, Utopie, Wahrheit, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation
Die Vernunft, die Musen und das Glück
Über Momente des Glücks, für die zu leben sich lohnt
In der Medizin setzen nicht-invasive Eingriffe inzwischen neue Maßstäbe. Derweil betreibt die Politik noch immer hemdsärmeligen Interventionismus. Vernunft oder gar Geist sind unerwünscht.
So ist die Homöopathie dieser Tage gestrichen worden von den Fortbildungen für Ärzten. Sie paßt nicht mehr in diese selbstverliebte Zeit. Man glaubt, größere Probleme nur mit schweren Waffen „lösen“ zu können. – Es wäre aber zu empfehlen, mehr über Soziale Systeme zur Kenntnis zu nehmen.
Die Maulaffen-Performance aus Coronas Zeiten wird unbeirrt weiter fortgesetzt. Dabei ist die Welt längst aus dem Rhythmus geraten, weil Politiker in vielen Ländern allen Ernstes meinten, sie könnten auf Handsteuerung umschalten. Größenwahn inmitten einer Krise ist das Dümmste, was passieren kann.
Es gibt nämlich gar kein Cockpit, keine Brücke mit Kapitän und Steuermann. Soziale Systeme haben alle ihren eigenen Autopiloten. Sie steuern sich selbst, ganz im Sinne ihrer internen Codes, ob Politik, Wissenschaft, Gesundheit, Recht, Religion, Kunst oder Liebe. – Es gibt keine Hebel der Macht. Das sind naïve Vorstellungen, die eigentlich nie der Wirklichkeit entsprachen.
Allerdings gibt es mehr oder minder große Dummheiten, die anfangs noch naiv, dann aber fahrlässig und bald schon unverantwortlich werden. „Gut gemeint“ ist nicht „gut gemacht“, beileibe nicht.
Wer sich keinen Kopf macht, kann ihn auch nicht verlieren, das glauben wohl manche von denen, die immer vorneweg sind:
„So tu doch was!“
„Was soll ich denn tun?“
„Das weiß ich auch nicht. -
Aber tu doch endlich irgendwas!“
Auch das 9 Euro-Ticket ist wieder so eine prekäre Meisterleistung. Es ist überhaupt keine gute Idee, gleich ganze Systeme zu marodieren, so wie zuvor noch die Kliniken in der Corona-Krise. Inzwischen sitzen alle erdenklichen Leute spaßeshalber im Zug und nehmen denen die Plätze weg, die nur zur Arbeit fahren. – Das Bahn-Bashing ist jetzt zur Freizeitunterhaltung geworden.
Oder der staatliche Tankrabatt, der nicht wirklich an der Tanksäule ankommt, weil er vorher abgefischt wird. Und dann regen sich alle wieder auf über die bösen Spekulanten. – Es war seinerzeit eine Freude, als manche davon kalt erwischt wurden im Lockdown.
Sie hatten große Kontingente an Sprit in Termingeschäften erworben aber gar keine eigenen Lagerkapazitäten. Als sie die Ware zum erhöhten Preis abnehmen sollten, mußten manche draufzahlen, damit ihnen irgendwer das Zeug zum Dumpingpreis noch vor der Lieferung abkauft.
Was kann Politik? Wenn sie klug, vielleicht sogar vernünftig oder eventuell auch geistreich wäre, dann könnte sie einiges bewirken. Aber nicht durch Södern, Flickschusterei und Populismus. Jetzt mal eben eine Übergewinnsteuer zu beschließen, ist bereits am wissenschaftlichen Dienst gescheitert. Das geht glücklicherweise nicht auch noch, weil ein paar Grundgesetze im Wege stehen.
Wir haben Privatwirtschaft und diese setzt sich selbst ihre Ziele, wie jedes andere System auch. – Schlechte Politik bringt aber die Systeme derart aus der Routine, so daß Desaster nicht mehr ausgeschlossen sind. So war und ist der Umgang des Staates mit Bahn, Bildung und Gesundheit einfach nur katastrophal. Mal eben Kindergärten und Schulen schließen, das war auch wieder so eine Meisterleistung.
Ins Gesundheitswesen hat die Politik derart krass hineinregiert, so daß der eigentliche Zweck längst ins Hintertreffen geraten ist. Geht es wirklich noch um Gesundheit, wo die Fallpauschalen alles beherrschen?
Neuerdings sind bereits die ersten Investoren auf besonders lukrative Arztpraxen aufmerksam geworden? Krankenhäuser sind bereits Spekulationsobjekte, die natürlich nur noch vorhalten, was sich rentiert, nicht gesundheitlich, sondern eben ökonomisch. – Und die Vorfinanzierung teurer Geräte für Facharztpraxen ist offenbar die nächste Stufe.
Aber die Patienten spielen mit und lassen sich brav von Termin zu Termin schicken. Es passiert ja was, es wird ja was getan. Auf den Dossiers der Laboruntersuchungen finden sich Handreichungen für den werten Leser, für die man keinen Arzt mehr braucht. – Es ist ausgewiesen, was als “normal” gilt und was gemessen wurde. Aber die Normalität wurde als solche oft aus ganz anderen Gründen beschlossen, die mit Gesundheit selbst nichts zu tun hat. So sind die Werte für Blutdruck immer wieder gesenkt worden und die Zahl der Patienten stieg. Die wundersame Vermehrung gibt es also auch in der Medizin.
Wer wird sich da noch vertrauensvoll in die Hände solcher Weißkittel begeben? – Aber die Leute vertrauen doch nur zu gern, um die eigenen Verantwortung nicht spüren und schon gar nicht tragen zu müssen. Wir leben in Zeiten eines neuen Paternalismus.
Die Allermeisten konsumieren ihre eigene Unmündigkeit. Sie wollen mit der eigenen Erkrankung höchstselbst eigentlich nichts zu tun haben. Also sind sie auch nicht wirklich bei der Sache, dabei sollte es doch eigentlich um Heilung gehen.
Krankheit ist dann kein Weg mehr, sondern nur wie Kalk im Wasserkessel, der weggemacht werden soll. Wenn ein Leiden “nur” psychisch bedingt ist, dann ist es eher so etwas wie pure Einbildung. – Nur, was sich messen läßt, hat ein Recht darauf, überhaupt ernst genommen zu werden. Kann man Geistlosigkeit messen?
Der neue Diskurs über Depression, der interessanterweise von namhaften Comedians wie Schmidt, Sträter und Krömer angestoßen wurde, dürfte allerdings nicht ohne Wirkung bleiben. – Es gibt zu denken, daß ausgerechnet die Lustigsten unter den Mitmenschen die erforderliche Eloquenz aufbringen, endlich zu sagen, daß der Clown hinter seiner Maske weint und wie ihm dabei zu Mute ist.
Wir leben in bewegten Zeiten. Es ist Chaos genug, mehr geht eigentlich nicht. – Im Hintergrund steht eine Medienrevolution, die ihresgleichen sucht. Nur noch die Erfindung des Buchdrucks kann der Kulturrevolution, die nun ansteht, überhaupt noch das Wasser reichen.
Unter diesen Umständen verändert sich auch die Rolle von Politikern ganz radikal. Daher rühren auch die fortwährenden Versuche, das Netz der Netze unter Kontrolle zu bekommen. – Aber so viel läßt sich jetzt schon mit Gewißheit sagen: Es wird nicht gelingen. Wenn es eine Energiequelle gibt, von der die Kulturgeschichte angetrieben wird, dann ist es die Sehnsucht nach Individualität und individueller Anerkennung.
In diesen Zeiten ist ein „Tal der Ahnungslosen“, wie noch in der DDR, als die Antennen bei Dresden nicht hoch genug sein konnten, um Westfernsehen zu empfangen, gar nicht mehr denkbar. In den hinterletzten Winkeln der Welt wissen alle, daß woanders ein anderes Leben geführt und andere Werte gelebt werden. Die dogmatische Begründung der „Hirten“, Tugendwächter und Gesinnungswächter, verfängt einfach nicht mehr. Es gibt immer Alternativen!
Auch im gar nicht mehr ganz so freien Westen zeigen sich Veränderungen. Die Diskurse finden nicht mehr nur in der „Systempresse“ statt, sondern überall. Und sie werden derart divers, so daß sich manche Vertreter der Presse in Missionare verwandelt haben, die wie vor Zeiten in fremden Ländern den „Aberglauben“ bekämpften, um ihre „frohe Botschaft“ vorzubereiten. – Ganz so froh war die Botschaft für die Natives dann doch nicht, wenn man bedenkt, daß außereuropäischen Kulturen einfach der eigenen Identität beraubt wurde, um sie unter die Fuchtel fremder Herrschaft zu zwingen und Geschäfte auf ihre Kosten zu machen.
Der Westen hat unendliches Leid über alle erdenklichen Kulturen gebracht. Schweigen wir hier von den Niederlanden, von Belgien oder Frankreich. Um nur ein Beispiel zu bringen: Die Briten haben während ihrer Besatzungszeit den Indern die Sinnenfreude ausgetrieben, weil sie bei sich zuhause gerade ihren Viktorianismus hatten und den Frauen gar keine und schon gar keine eigene Lust zugestehen mochten. – Noch heute zeigen sich die traumatischen Spätfolgen in Indien anhand von Gewaltverbrechen mit sexuellem Hintergrund.
Die fremde Herrschaft ist zwar abgezogen, man hat aber seither keinen eigenen Umgang mit Sinnenfreuden mehr, sondern eine repressive Scheu und ein Schamempfinden, unter dem es brodelt und kocht. – Die Kultur wurde mutwillig zerstört, nur um Geschäfte zu machen. Es fehlt der Respekt vor dem Geist, wo immer nur aufs Materielle gestarrt wird.
Man denke nur an den Opiumhandel in China. Das geschah, um die eigentlich stabile Kultur in China empfindlich zu schwächen und das Land mithilfe dieser Sucht in die Kniee zu zwingen. – Der Westen möge sich also bitte nicht so aufspielen, er sollte erst einmal Buße tun, im Gedenken an diese Verbrechen. Und wenn man bedenkt, daß ein Gutteil der Landesgrenzen von den Briten gezogen wurde, in Afrika und in Asien, bewußt mitten durch Stammesgebiete, weil man den Hader immer wieder für eigene Zwecke instrumentalisieren wollte.
Man kann inzwischen erstaunlich viel über miese Machenschaften wissen. Das meiste davon ist nicht einmal mehr geheim, sondern läßt sich im Zweifelsfall mit Links sehr schnell dokumentieren. Das ist es, was das Netz ausmacht. – So war es eine Sternstunde, als die Planespotter an verschiedenen Flughäfen der Welt ihre Beobachtungen untereinander abstimmten und dann publik wurde, daß es regelrechte Folterflüge im Auftrag der CIA gab und daß die USA in Europa geheime Gefängnisse betreibt.
Wir stehen erst am Anfang einer neuen, unübersehbar mächtigen Kulturrevolution. So etwas dauert mehrere Generationen und das Netz läuft sich gerade erst warm.
Auf eine Medienrevolution folgt immer eine Kulturrevolution, weil ja nun noch mehr Menschen miteinander ins Gespräch kommen, ohne daß sich Herrscher oder Priester noch dazwischenschalten könnten.
Zuvor entschied die Kirche, ob und wie ein Text das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Aber der Buchdruck machte die Kontrolle der Kommunikation durch die Kirche unmöglich. Fortan entschieden schnell namhaft werdende Drucker, was sie drucken wollten, aus ganz eigenen Motiven heraus. – Darauf ging die Zensur von der Kirche an den Staat über.
Martin Luther hielt nicht viel vom Buchdruck, aber bösartige Karikaturen über Papst und Kirche brachten seiner Reformation erst den richtigen Schwung. Der Papst als Schwein mit der dreifachen Krone, das konnten auch Leute verstehen, die noch nicht des Lesens mächtig waren.
Darauf kam die Zeitungspresse und mit ihr kamen Parlamente, Parteien und Politiker. Und mit dem Radio kamen totalitäre Systeme auf, wie Faschismus oder Sozialismus. Neue Medien sind zu vielerlei einsetzbar, im Guten wie auch im Bösen. – Derweil splittet „die“ Öffentlichkeit sich immer weiter auf. Es gibt nicht mehr die einzig wahre herrschende Meinung aller Wohlmeinenden und Wohlinformierten.
Manche unter den Politikern kommen in ihrer neuen Rolle gar nicht mehr an. Sie können sich nicht mehr als „Repräsentanten“ verstehen, als Volksvertreter, weil das „Volk“ selbst mündig geworden ist und niemanden mehr braucht, der noch das Wort stellvertretend ergreift.
Die Zeiten sind vergangen, als Politiker noch in aller Eitelkeit betonten, sie seien die nächste Woche wieder in der Hauptstadt. Dort würden sie dann turnusmäßig auf irgendeine Wichtigkeit von Mensch treffen, um bei Gelegenheit das gemeinsame Anliegen umso dringlicher vorzutragen. – Man sollte sich aufgehoben, ernst genommen, verstanden und vertreten fühlen.
Jetzt braucht es sie nicht mehr, diese Form der Repräsentative Demokratie, weil sich alle selbst ausdrücken und insofern auch repräsentieren können. Es gilt, endlich mehr Demokratie zu wagen. – Warum wählen wir den Bundespräsidenten nicht online? Wahlmänner braucht es nicht mehr, also auch nicht mehr eine Bundesversammlung.
Die Rolle von Religionsfürsten, Priestern und „Hirten“ ist vakant geworden. Daher ist es auch kein Skandal mehr, wenn sich ein Bischof aus dem Ruhrgebiet vor etwa 10 Jahren in voller Überzeugung noch gegen die gleichgeschlechtliche Elternschaft aussprach, von wegen, das sei „widernatürlich“, Kinder bräuchten nun einmal Vater und Mutter. Das ist inzwischen einfach nur noch eine beliebige Meinungsäußerung. – Rosa von Praunheim saß mit in der Diskussionsrunde und sagte baff nicht ohne Schmunzeln: Daß er das noch mal erleben dürfte!
Es ist alles auch ein bißchen viel, was sich in den letzten Jahrzehnten so alles radikal gewandelt hat. Und Manchen geht es noch immer nicht schnell genug. Dagegen hilft eine Sentenz von Niklas Luhmann: Viele würden immerzu noch mehr Veränderungen verlangen, ohne aber zu bedenken, „wie schnell wir schon fahren“.
Jede Intervention führt zu Gegen-Reaktionen von Seiten der Sozialen Systeme, die sich ihrerseits auf die veränderten “Umweltbedingungen” einstellen, wie die Mineralöl-Spekulanten, die bei der Gelegenheit ganz außerordentliche Gewinne erwirtschaften werden. – Das stützt übrigens auch einen schlimmen Verdacht, dem bedingungslosen Grundeinkommen gegenüber.
Im Prinzip kann man nur für ein Grundgehalt sein, wenn es denn wirklich so kommen würde, wie es im Traum erscheint: Eine Gesellschaft, in der Menschen einander durch Kreativität beglücken, die sich endlich darauf verstünde, die vielen schlummernden Talente in vielen von uns zu erwecken. Wäre das nicht wirklich lebenswert und sogar liebenswert? – Aber wie beim Tankrabatt würde schlußendlich nur eines die Folge eines solchen Grundeinkommens sein: Die Mieten würden steigen, weil Vermieter nun einmal mit Mietwohnraum spekulieren, um möglichst hohe Gewinne zu erzielen.
Nein, die Welt ist überhaupt nicht einfach. Das Getue von Politikern mit ihrem Hang zum Interventionismus ist Budenzauber. Deswegen hat man den Tankrabatt auch nicht an dem Großhandel gegeben, dann wäre er an den Tankstellen angekommen. Auf den Hype kam es an, auf die Show, what ever it costs.
Die Religion soll dieser Tage durch eine deterministische Wissenschaft ersetzt werden, die päpstlicher sein soll als der Papst. – „Follow the Science?“, da fragt sich nur wohin. Im übrigen, gibt es etwas Dümmeres als diesen Spruch?
Man kann eine Hürde auch nehmen, indem man sie nicht etwa überspringt, sondern “unterbietet”, wie Trump, Johnson, Erdogan, Putin, Jong-un oder auch wie die Taliban. Wenn man nur die Frauen oder auch die Andersdenkenden aus vorgeschobenen Glaubensgründen möglichst radikal unterdrückt, dann wird alles wieder gut. – Sorry, welcher Gott sollte daran Gefallen finden?
Um abzulenken werden Probleme zur Not auch künstlich erzeugt und dann „gelöst“. Im Hintergrund stehen zumeist tiefer liegende Ressentiments gegen die Moderne, gegen jede Emanzipation und vor allem gegen Vernunft und Geist. Alles soll so bleiben wie es ist, besser noch, alles soll so werden, wie es einmal war, als alles angeblich noch gut war. – Aber auch das funktioniert mit Sicherheit nicht.
Der treibende Faktor im Prozeß der Zivilisation ist Individualisierung. Alle suchen so gut sie können nach sich selbst, wollen sich spüren und sehen lassen können in ihrer Einzigartigkeit. Aber die Wenigsten wissen von sich, wer sie eigentlich sind oder sein wollen, ganz unabhängig vom Sollen. – Was hilft?
Philosophie kann helfen, wenn es darum geht, mehr Boden unter die Füße zu bekommen. Man kann nicht alles zugleich anzweifeln und sollte schon gar nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt. Der Reihe nach, also mit Methode geht das durchaus. – Wichtig und wesentlich ist aber vor allem eines, daß geredet wird. Es braucht Dialoge und Diskurse vor allem über das, was peinlich sein könnte, über Ängste, Gefühle, Sehnsüchte, Gelüste, Unsicherheiten, Rollenkonflikte. Wenn immer mehr Menschen einander authentisch begegnen, dann können Dialoge entstehen, die den Horizont wirklich erweitern. Dann könnte es auch sein, daß manche dieser Bannflüche brechen, mit denen wir uns und unseresgleichen immerzu klein machen und klein halten.
Derzeit ist jedoch allenthalben ein Mangel an Geist, an Bescheidenheit und ein Mangel an Gelassenheit zu verzeichnen. Man glaubt ernsthaft, überall hineinpfuschen zu können, ohne wirklich eine Ahnung zu haben von dem, was da eigentlich vor sich geht in den Systemen.
Wer hat denn die Endokrinologie wirklich so auf dem Schirm, daß die Wirkung künstlicher Hormongaben nicht nur so ungefähr verstanden wird, sondern in ihrer ganzen Wechselwirkung bis hinauf zur Seele, zur Psyche und bis hin zum Geist beurteilen zu können? – Es müßte schon ein Universalgenie sein, daß es so nicht mehr geben kann. Also braucht es den Streit der Fakultäten, aber keine Einheitspartei, keine Einheitswissenschaft und auch keinen Einheitsbrei.
In der Tat steht ein Kurswechsel an, der Ausstieg aus dem Carbon-Zeitalter und der Einstieg in die Welt der regenerativen Energie. – Politik kann im Namen des Staates die Rahmenbedingungen schaffen oder auch verändern. Populismus ist aber kontraproduktiv.
Ein schönes Beispiel für gelungene Politik ist das Patentrecht. Ein Erfinder wird seine Erfindung geheim halten wollen, weil er nichts davon hätte, wenn andere ernten, was er gesät hat. – Genau das aber wäre nicht im Sinne von Wirtschaft und Gesellschaft. Deren Interesse besteht vielmehr darin, daß Patente öffentlich gemacht werden. – Also verbürgt sich der Staat dafür, daß die Rechte des Urhebers gewahrt bleiben. Dafür muß aber die Erfindung öffentlich gemacht werden, und der Erfinder erhält darauf sein Patent, mit dem er am Markt mit den Verwertern auftreten und verhandeln kann. Es braucht also eigentlich nicht viel, um ganz gewaltig etwas zu verändern, so daß es auf den richtigen Kurs kommt.
In der chinesischen Philosophie gibt es dazu ein Prinzip, es ist das „Wu Wei“, was bedeutet „Nicht-Tun“. Damit ist aber keineswegs „Nichtstun“ gemeint, vielmehr geht es um eine Philosophie der Intervention. Es kommt darauf an, mit geringfügigen Eingriffen die entscheidenden Reize zu setzen, um einen Kurswechsel in die gewünschte Richtung zu bewirken. Das macht gute Politik zur Kunst.
Das macht gute Pädagogik, gute Psychologie, gute Philosophie aus. In den Dialogen sind Mentoren nur anwesend und tun dabei, rein äußerlich betrachtet, nicht sonderlich viel. Sie “moderieren” und sind wie die Katalysatoren in der Chemie oder in der Biologie. – Wenn und solange sie anwesend sind, wird aber das Unmögliche möglich.
Reaktionen, für die eigentlich anspruchsvolle Rahmenbedingungen erforderlich sind, gehen ohne Probleme vonstatten, als wäre ein ganz besonderer Zauber im Spiel. – Die Meme, also gute Ideen haben etwas von solcher Zauberkraft. Wesentlich ist, daß ein Geist aufkommt, der die Musen zur Hilfe rufen kann, so daß man sich vor Begeisterung vor so vieler guter Einfälle kaum noch erwehren kann.
Dann gilt es, mit bewußter Unterkühlung die einzelnen Optionen zu prüfen und womöglich ins Konzept zu bringen. Das wäre gute Politik, das ist aber bereits Kunst und vielleicht auch Philosophie, wenn denn das Gute, Schöne und Wahre wirklich zusammengebracht werden könnten.
Wenn sich im Dialog die erlösenden Worte einstellen, so daß wir endlich sagen können, was schon längst sollte gesagt und verstanden worden sein, erst dann kommen wir uns selbst und einander näher in einem Verstehen, das seine Basis gefunden hat. Das sind Momente des Glücks, für die es zu leben sich lohnt.
Die Wirklichkeit selbst wird immer vielfältiger, nur schwarz-weiß oder wenigsten grau zu denken, sie Sloterdijk anregt, ist noch immer nicht farbig. Aber das wäre vielleicht auch ein wenig zu viel des Guten. – Dagegen ist aber auch der kausalfetischistische Ungeist keineswegs dazu angetan, wirklich auf gute Ideen zu kommen.

Johan König: Athene und die Neun Musen an der Quelle von Hipokrene (1624). Wie wäre es, wenn sich die Vernunft und die Musen zusammentun? – Wenn ich darüber spekuliere, wie die Vernunft es wohl macht, wenn sie ein Modell dessen erstellen soll, worauf es insgesamt ankommt, dann wird es doch wohl nicht im Sinne der MINT-Fächer sein, nicht im Sinne der vielberufene “Rationalität” oder “Wissenschaftlichkeit”, denn es gibt so viele davon wie Götter im Pantheon.
Der Leitstern kann nicht der allenthalben bemühte Kausal-Fetischismus sein, der in der Corona-Krise schon so viel geistige Verwirrung gestiftet hat. Nein, die Vernunft optimiert sich in Hinsicht auf Schönheit, als Einheit des Wahren, Schönen und Guten. – Dieser Meta-Diskurs sollte endlich an die Stelle der Papstkirche treten, um die alten Götter ebenso wie die Musen dazu zu bewegen, ihre uralten Kämpfe, Tänze und Inspirationen wieder aufzunehmen. -
Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Politik, Diskurs, Identität und Individualismus, Moderne, Psyche, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Zeitgeist, Zivilisation
Nähe und Enge
Wenn es eng wird ums Herz
“Wann Krieg beginnt, das kann man wissen, aber wann beginnt der Vorkrieg. Falls es da Regeln gäbe, müßte man sie weitersagen.” (Christa Wolf: Kassandra. Voraussetzungen einer Erzählung. Frankfurter Poetik–Vorlesungen; Darmstadt, Neuwied 1983. S. 76f.)
Es gibt einen ethisch nicht zulässigen Tierversuch: Zwei Ratten werden in einen Käfig gesperrt, der eine ziemlich klar definierte Größe unterschreitet. Dann gehen sich beide augenblicklich an die Gurgel, bis nur noch eine übrig bleibt.Auf mehrtägigen Veranstaltungen gibt es diesen magischen 3. Tag. Auch da gehen sich Teilnehmer aus einem inneren Zwang heraus an, weil irgendeine Geduld am Ende ist und man vom vielen Weglächeln allmählich Gesichtskrämpfe bekommt. — Es ist auch komisch, wenn gleich ganz viele wie auf ein geheimes Kommando ziemlich unvermittelt und aufgrund von Nichtigkeiten plötzlich aufeinander losgehen.Wenn man als Referent später dazu kommt und wissen möchte, wie die Stimmung so ist, kann man sehr gut Teilnehmerinnen befragen. Frauen haben es wie selbstverständlich auf dem Schirm, wer mit wem, warum nicht und weswegen. — Ich bin da immer bass erstaunt, wie leicht frau Gruppendynamik durschauen kann, weil ich dazu mit Bordmitteln ziemlich lange brauche, bis ich es auch sehe.
Jérôme-Martin Langlois: Cassandra fleht Minerva an, sich an Ajax zu rächen (1810). Es ist überaus wichtig, hinter die Kulissen zu schauen. Das ist auch der Sinn von Höflichkeit, denn es gilt, anderen zuvorkommend zu begegnen, so daß sie gar nicht erst Beklemmungen bekommen, sondern sich wohlfühlen, verstanden, geachtet, gewürdigt. — Das läßt sich sehr schön bei Knigge studieren, dem es mitnichten um den Einsatz des Fischmessers geht.Tatsächlich ist Gesellschaft immer auch Theater. Wir spielen unsere Rollen und dabei uns selbst und anderen etwas vor. Aber was wäre die Alternative? — Der Untertitel bei Knigge lautet, vom Umgang mit Menschen. Dabei geht es um eine Diplomatie, die alles andere ist als Schmeichelei oder Manipulation. Allerdings ist dazu ein wenig Lebensart und Lebenserfahrung erforderlich und vor allem ein humanistischer Geist.Das Rollenspiel ist ja selbst wieder ein Medium, eine Sprache, mit der wir uns darstellen. Das wird einem klar bei einer Empfehlung, die Knigge gibt: Seinerzeit war die Bewegungsfreiheit nicht so wie heute. Nur Adelige und Handwerksgesellen durften und mußten reisen, um sich in der weiten Welt zu beweisen. In der Tat lernt man sich selbst am besten in der Fremde kennen und vor allem dann, wie man mit dem Unbekannten umgehen muß.Wenn man in der Stadt eine Kutsche gemietet hat und die Kutscher wie verrückt losfahren, sollte man sich keineswegs darüber beschweren. Es geht nur um eine Belastungsprobe. Wenn nämlich die Räder schwach sind, dann sollten sie hier und jetzt brechen – aber nicht im Wald, wo bekanntlich die Räuber sind.Die meisten Probleme entstehen durch nicht thematisiertes Mißverstehen. Es ist falsche Höflichkeit, irgendeine Form zu wahren, aber nicht auf das zu sprechen zu kommen, was wirklich von Bedeutung ist, um einander zu verstehen. — Das ist voraussetzungsreicher als gedacht. Zunächst müßte man erst einmal sich selbst verstehen und dann auch den Anderen. Dann braucht man eine gemeinsame Gesprächsgrundlage, wie es schon im Jargon der Diplomaten heißt. Das alles verlangt der Sprache derart viel ab, so daß viele lieber alles weglächeln und Meta–Toleranz–Gepflogenheiten vor sich hertragen oder auch Parteinahmen, je nach Tagesbefehl, wasnoch mehr Probleme bereitet.Die Welt ist in der Tat abhängig vom Willen und von der Vorstellung, die man sich darüber macht oder auch nur machen läßt. Das hat die Corona-Krise leidlich unter Beweis gestellt. Die Grenzen zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten, zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft, wurden ständig verletzt. Man hat sich in eine Stimmung aus Panik, Furcht und Bedrohung versetzen und dauerhaft halten lassen.Und jetzt erscheint es so, als wäre Corona nur eine Art Vorkrieg gewesen. Die Polarisierung der Gesellschaft, der Kultur, mancher Gemeinschaften und das Gefühl, im Anderen eine infektiöse Bedrohung zu sehen und Nähe generell fürchten zu müssen, sich auf nichts mehr verlassen zu können, schon gar nicht auf das eigene Immunsystem, das hat alles sehr viel mehr Schaden angerichtet, als manche bereit wären, sich zuzugestehen.Auch ist es kein Zufall, daß nunmehr mit möglichst großer Öffentlichkeit dieses toxische Männlichkeitsgehabe wieder fröhliche Urstände feiert. — Wie war es noch, als Deutsche in den Krieg fuhren? Das taten sie ja nur, um dort mit ihrer neuen, französischen Geliebten auf der Chaussee de Elysee flanieren zu gehen. Zurück kamen sie, wenn überhaupt, zutiefst traumatisiert.Die Weltkriege haben diese Schattenfiguren des prekären Maskulinismus erzeugt, einen manisch-depressiven Männertyp, der nicht sprechen kann über die Scheußlichkeiten, die nicht wieder verschwinden wollen. Also liegt er den ganzen Tag auf der Couch, bekommt aber einmal am Tag seinen Anfall, die ganze Familie zu vermöbeln.Das gegenwärtige, affenhafte Brustklopfen der Machomanie ist ja nur das, was im Vorkrieg demonstriert wird. Später wird sich die Gesellschaft in großer Dankbarkeit für die erbrachten Opfer von diesen Helden nur noch angewidert abwenden. Also was soll das?Es ist kein Kunststück, gegen den Krieg zu sein, gegen jeden, weil das einfach für nichts gut ist. Außerdem befand man sich schon immer in der besseren Gesellschaft mit denen, die sich ein eigenes Urteilsvermögen zutrauen und auch zumuten mochten. — Zwischen der Zustimmung zur Impfung und der Zustimmung zum Krieg gibt es eine gespenstische Gemeinsamkeit.I am not convinced. — Wo kommt nur das Bedürfnis nach Haß her? Ist es nicht eine viel zu späte Reaktion darauf, daß man sich wieder einmal hat viel zu viel Duldsamkeit abverlangt, zu viel Nähe zugemutet und zu wenig Verstehen aufgebracht hat? Warum wehren sich so wenige gegen Übergriffe und lächeln sich weg? Warum kommt es dazu, daß man irgendwann einfach platzt, wenn es bereits zu spät ist? Das ist falsche Höflichkeit, das ist Feigheit, Unbedarftheit, Unselbstständigkeit, Unsicherheit, Unmündigkeit.Warum haben so viele die Gelegenheit zum Bashing nicht verstreichen lassen, um auch mal ganz kräftig auszuteilen? — Die Gründe liegen woanders, in einem allgemeinen Unglücklichsein, das mit dem eigentlichen Anlaß kaum etwas zu tun hat.In einem Mangel an Denken und Sprache liegen die eigentlichen Gründe. Daher laufen die Konflikte völlig aus dem Ruder nach dem Motto: Und was ich Dir überhaupt immer schon mal sagen wollte…! — Machtworte sind Verlautbarungen einer Ohnmacht, aus Gründen der Sprache, des Denkens und aus Mangel an Geist.Als Ethologen einem Volk ohne Fernseher vom Weltkrieg erzählten, haben sich diese zunächst köstlich amüsiert. So etwas bräuchten sie auch mal. Offenbar dachten sie an eine zünftige Wirtshausschlägerei, die sie auch noch nicht kannten. — In einem Science Fiction las ich mal über eine fremde Spezies, sie seien ursprünglich sehr kriegerisch gewesen, dann aber hätten sie sich selbst immer weiter pazifiziert. Aber von Zeit zu Zeit bräuchten sie noch eine Drangwäsche, ein bemerkenswertes Wort für das, was da gerade vor sich geht.Es ist vielen zu eng geworden. Es wäre aber besser, einander mehr Raum zu gewähren. Raum gewähren kann man auch durch mehr Verständnis, etwa für die, die sich gerade völlig verunsichert in den Geschäften bewegen, daß jetzt keine Maskenpflicht mehr herrscht. Aber wo kommen wir da jetzt hin, wenn jeder wieder macht was er oder sie will! – Genau das ist das Problem, dieses unausgesprochene Mißtrauen, der verborgene Selbst– und Menschenhaß.Der Liberalismus steht einer rechtskatholische Tiefengesinnung gegenüber und einer Reihe von selbstüberzeugten Besserwissern, die in sich das Potential zum guten Diktator verspüren. Nicht nur Krieg, sondern auch Diktatur scheint wieder machbar.Aber der Liberalismus hat den Humanismus auf seiner Seite. Er kann sagen, warum wir uns in unserer Freiheit selbst finden und entwickeln müssen. Nur so wird aus Menschen das, was sich aus ihrer Emanzipationsgeschichte längst herauslesen läßt, Wesen individueller Weisheit, Selbstverantwortung, Empathie, Authentizität und einem immens gestiegenen Verbalisierungsvermögen.Erst wenn wir sagen können, was mit uns und der Welt nicht stimmt, wenn wir auch in der Bewegtheit noch die Contenance bewahren können, um uns gleichwohl nicht unterbuttern zu lassen, erst dann sind wir auf dem richtigen Weg. — Dabei ist die Bezeichnung Homo sapiens bislang nur eine Anmaßung.Die letzte aller Kompetenzen ist die schwerste von allen, das ist in jeder Entwicklung so. Sich selbst moderieren zu können, freundschaftlich, verständnisvoll und hoffnungsvoll, das ist einzig das, was zählt. Der Staat hat überhaupt nicht das Recht, sich da einzumischen. Er hat nicht die Aufgabe, über die Gesellschaft zu herrschen, er hat ihr zu dienen, um sie darin zu unterstützen, zu sich selbst zu kommen. — In Pädagogik und Psychologie ist das der state of the art, alle Eltern wissen das. -
Anthropologie, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Kunst, Lehramt, Lehre, Lüge, Moderne, Moral, Motive der Mythen, Politik, Professionalität, Psyche, Religion, Schule, Seele, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wahrheit, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation
EPG II b (online und Block)
Oberseminar
EPG II b (Online)
Ethisch–Philosophisches Grundlagenstudium II
SS 2022 | Beginn: 30. Juni 2022 | Ende: 14. August 2022 | Online und Block
Ab 30. Juni 2022: 5 Seminare online | donnerstags: 14:00–15:30 Uhr, sowie3 Workshops im Block: 12., 13., 14. August 2022 | 14–19 Uhr | Raum: 30.91–110Zum Kommentar als PDF

Universe333: YogaBeyond Honza & Claudine Bondi; Beach, Australia 2013. — Quelle: Public Domain via Wikimedia Commons. Zwischen den Stühlen
Eine Rolle zu übernehmen bedeutet, sie nicht nur zu spielen, sondern zu sein. Wer den Lehrerberuf ergreift, steht gewissermaßen zwischen vielen Stühlen, einerseits werden höchste Erwartungen gehegt, andererseits gefällt sich die Gesellschaft in abfälligen Reden. — Das mag damit zusammenhängen, daß jede® von uns eine mehr oder minder glückliche, gelungene, vielleicht aber eben auch traumatisierende Schulerfahrung hinter sich gebracht hat.
Es sind viele potentielle Konfliktfelder, die aufkommen können im beruflichen Alltag von Lehrern. Daß es dabei Ermessenspielräume, Handlungsalternativen und vor allem auch Raum gibt, sich selbst und die eigenen Ideale mit ins Spiel zu bringen, soll in diesem Seminar nicht nur thematisiert, sondern erfahrbar gemacht werden.
Das Selbstverständnis und die Professionalität sind gerade bei Lehrern ganz entscheidend dafür, ob die vielen unterschiedlichen und mitunter paradoxen Anforderungen erfolgreich gemeistert werden: Es gilt, bei Schülern Interesse zu wecken, aber deren Leistungen auch zu bewerten. Dabei spielen immer wieder psychologische, soziale und pädagogische Aspekte mit hinein, etwa wenn man nur an Sexualität und Pubertät denkt. — Mitunter ist es besser, wenn möglich, lieber Projekt–Unterricht anzuregen, wenn kaum mehr was geht.Es gibt klassische Konfliktlinien, etwa Eltern–Lehrer–Gespräche, in denen nicht selten die eigenen, oft nicht eben guten Schul–Erfahrungen der Eltern mit hineinspielen. Aber auch interkulturelle Konflikte können aufkommen. Das alles macht nebenher auch Kompetenzen in der Mediation erforderlich. — Einerseits wird individuelle Förderung, Engagement, ja sogar Empathie erwartet, andererseits muß und soll gerecht bewertet werden. Das alles spielt sich ab vor dem Hintergrund, daß dabei Lebenschancen zugeteilt werden.
Gerade in letzter Zeit sind gestiegene Anforderungen bei Inklusion und Integration hinzugekommen. Auch Straf– und Disziplinarmaßnahmen zählen zu den nicht eben einfachen Aufgaben, die allerdings wahrgenommen werden müssen. — Ein weiterer, immer wieder akuter und fordernder Bereich ist das Mobbing, das sich gut ›durchspielen‹ läßt anhand von Inszenierungen.
Es gibt nicht das einzig richtige professionelle Verhalten, sondern viele verschiedene Beweggründe, die sich erörtern lassen, was denn nun in einem konkreten Fall möglich, angemessen oder aber kontraproduktiv sein könnte. Pädagogik kann viel aber nicht alles. Bei manchen Problemen sind andere Disziplinen sehr viel erfahrener und auch zuständig. — Unangebrachtes Engagement kann selbst zum Problem werden.
Wichtig ist ein professionelles Selbstverständnis, wichtig ist es, die eigenen Grenzen zu kennen, und mitunter auch einfach mehr Langmut an den Tag zu legen. Zudem werden die Klassen immer heterogener, so daß der klassische Unterricht immer seltener wird. — Inklusion, Integration oder eben Multikulturalität gehören inzwischen zum Alltag, machen aber Schule, Unterricht und Lehrersein nicht eben einfacher.
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit setzen zwar hohe Erwartungen in Schule und Lehrer, gefallen sich aber zugleich darin, den ganzen Berufstand immer wieder in ein unvorteilhaftes Licht zu rücken. — Unvergessen bleibt die Bemerkung des ehemaligen Kanzlers Gehard Schröder, der ganz generell die Lehrer als faule Säcke bezeichnet hat.
„Ihr wißt doch ganz genau, was das für faule Säcke sind.“
Dieses Bashing hat allerdings Hintergründe, die eben darin liegen dürften, daß viel zu viele Schüler*innen ganz offenbar keine guten Schulerfahrungen gemacht haben, wenn sie später als Eltern ihrer Kinder wieder die Schule aufsuchen.
Ausbildung oder Bildung?
Seit 2001 ist das Ethisch–Philosophische Grundlagenstudium (EPG) obligatorischer Bestandteil des Lehramtsstudiums in Baden–Württemberg. Es besteht aus zwei Modulen, EPG I und EPG II. — Ziel des EPG ist es, zukünftige LehrerInnen für wissenschafts– und berufsethische Fragen zu sensibilisieren und sie dazu zu befähigen, solche Fragen selbständig behandeln zu können. Thematisiert werden diese Fragen im Modul EPG II.
Um in allen diesen Konfliktfeldern nicht nur zu bestehen, sondern tatsächlich angemessen, problembewußt und mehr oder minder geschickt zu agieren, braucht es zunächst einmal die Gewißheit, daß immer auch Ermessens– und Gestaltungsspielräume zur Verfügung stehen. Im Hintergrund stehen Ideale wie Bildung, Entfaltung der Persönlichkeit, die Erfahrung erfüllender Arbeit und Erziehungsziele, die einer humanistischen Pädagogik entsprechen, bei der es eigentlich darauf ankäme, die Schüler besser gegen eine Gesellschaft in Schutz zu nehmen, die immer fordernder auftritt. In diesem Sinne steht auch nicht einfach nur Ausbildung, sondern eben Bildung auf dem Programm.
Auf ein– und dasselbe Problem läßt sich unterschiedlich reagieren, je nach persönlicher Einschätzung lassen sich verschiedene Lösungsansätze vertreten. Es ist daher hilfreich, möglichst viele verschiedene Stellungnahmen, Maßnahmen und Verhaltensweisen systematisch durchzuspielen und zu erörtern. Dann läßt sich besser einschätzen, welche davon den pädagogischen Idealen noch am ehesten gerecht werden.
So entsteht allmählich das Bewußtsein, nicht einfach nur agieren und reagieren zu müssen, sondern bewußt gestalten zu können. Nichts ist hilfreicher als die nötige Zuversicht, in diesen doch sehr anspruchsvollen Beruf nicht nur mit Selbstvertrauen einzutreten, sondern auch zuversichtlich bleiben zu können. Dabei ist es ganz besonders wichtig, die Grenzen der eigenen Rolle nicht nur zu sehen, sondern auch zu wahren.
Stichworte für Themen
#„ADHS“ #Aufmerksamkeit #Bewertung in der Schule #Cybermobbing #Digitalisierung #Disziplinarmaßnahmen #Elterngespräche #Erziehung und Bildung #Genderdiversity #Heldenreise und Persönlichkeit in der Schule #Inklusion #Interesse–Lernen–Leistung #Interkulturelle Inklusion #Islamismus #Konflikte mit dem Islam in der Schule #Konfliktintervention durch Lehrpersonen #LehrerIn sein #Lehrergesundheit #Medieneinsatz #Medienkompetenz #Mitbestimmung in der Schule #Mobbing #Online-Unterricht #Political Correctness #Professionelles Selbstverständnis #Projektunterricht #Pubertät #Referendariat #Respekt #Schule und Universität #Schulfahrten #Schulverweigerung #Sexualität und Schule #Strafen und Disziplinarmaßnahmen #Ziviler Ungehorsam
Studienleistung
Eine regelmäßige und aktive Teilnahme am Diskurs ist wesentlich für das Seminargeschehen und daher obligatorisch. — Studienleistung: Gruppenarbeit, Präsentation und Hausarbeit.
-
Anthropologie, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Kunst, Künstler, Melancholie, Moderne, Moral, Motive der Mythen, Platon, Politik, Psyche, Psychosophie, Religion, Seele, Theographien, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wahrheit, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation
Schuld: Eine mächtige Kategorie

Johann Heinrich Füssli: Lady Macbeth, schlafwandelnd, (um 1783). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Gewissensbisse, die zum Wahnsinn führen
Der Dichter und Maler Johann Heinrich Füssli war derart fasziniert von den Werken des William Shakespeare, so daß er sich schon in jungen Jahren an Übersetzungen versuchte. — Als Maler schuf er einen ganzen Bilder–Zyklus mit berühmten Szenen, in denen die phantastische Stimmung eingefangen ist.
So inszenierte er auch die dramatische Szene: Lady Macbeth V,1 von William Shakespeare. Die tragische Heldin wird von Alpträumen geplagt und findet einfach keine Ruhe mehr. Sie träumt mit offenen Augen und beginnt zu schlafwandeln. — Und es scheint, als wollte sie sämtliche Plagegeister vertreiben, die Zeugen ihrer Untaten, von denen sie verfolgt und um den Schlaf gebracht wird.
Die Szenerie führt das schlechte Gewissen der Lady Macbeth vor Augen. — Ihr Mann war zunächst dem König treuergeben. Aber drei Hexen prophezeien ihm, selbst zum König zu werden. Um dem verheißenen Schicksal nun aufzuhelfen, schrecken Macbeth und seine Lady selbst vor einem heimtückischen Königsmord nicht zurück.
Beide sind von blindem Ehrgeiz getrieben und verlieren im Verlauf der Ereignisse aufgrund ihrer Verbrechen zuerst ihre Menschlichkeit, dann ihr Glück und schließlich auch noch den Verstand, von ihrem Seelenheil ganz zu schweigen. — Dabei wirkt die Frau skrupelloser als der Mann. Ähnlich wie auch die Medea, setzt eine sehr viel entschiedenere Frau wirklich alles aufs Spiel, während der Mann eher zaghaft erscheint. Dahinter dürfte die Problematik stehen, daß Frauen lange Zeit nicht direkt aufsteigen konnten, nur über ihre Rolle als Ehefrau und Mutter.
Es kommt im fünften Akt zu der im Bild von Füssli dargestellten Szene. Während sich Macbeth auf Burg Dunsinane mehr und mehr zum verbitterten, unglücklichen Tyrannen wandelt, wird Lady Macbeth immer heftiger von Gewissensbissen geplagt, denn die Schuld am Mord von King Duncan ist ungesühnt. — Alpträume kommen auf, sie beginnt im Schlaf zu wandeln und die Phantasie nimmt Überhand, bis sie schließlich den Verstand verliert und sich das Leben nimmt.
Das Gefühl, sich womöglich gleich am ganzen Kosmos versündigt zu haben, durch eine Freveltat, dürfte sehr früh aufgekommen sein. Es gibt viele Beispiele dafür, daß durch ein Sakrileg eine ›heilige Ordnung‹ gestört wird, was nicht so bleiben kann. — Beispiele sind Sisyphos, ein Trickster, der nicht sterben will und den Tod immer wieder hinters Licht führt, oder Ixion, der erstmals einen Mord an einem Verwandten beging.
Es gibt eine Klasse von Mythen, die sich als Urzeitmythen klassifizieren lassen. Väter verschlingen ihre Kinder, die Welt bleibt im Chaos, sie gewinnt gar keine Gestalt. Titanen herrschen, wobei der Eindruck entsteht, als wären sie die Verkörperung jener Geister, mit denen die Schamanen der Vorzeit noch umgehen konnten. — Die klassischen Mythen sind insofern auch ein Spiegel der Zivilisation, weil sie die angeblich barbarischen Zeiten zuvor als absolut brutal in Szene setzen.
Erynnien, Furien, Rachegötter und Plagegeister

Francisco de Goya: Saturn verschlingt seinen Sohn (1820f). — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Das sind auch Ammenmärchen der Zivilisation, die Rede ist dann von finsteren Zeiten. Zugleich setzen sich Mythen damit als Aufklärung in Szene, schließlich künden sie von der Überwindung dieser Schrecklichkeiten. Nicht nur der technische, zivilisatorische Fortschritt spielt bei alledem eine beträchtliche Rolle, sondern auch die Psychogenese. — Vermutlich kommt Individualismus erst allmählich auf, ebenso wie das Bedürfnis, sich selbst zu beobachten.
Die klassischen Mythen inszenieren nicht nur das Sakrileg, sie errichten zugleich auch die Tabus dagegen, indem man die Ereignisse in eine viel frühere Urzeit abschiebt und zugleich demonstriert, wie entsetzlich die Folgen möglicher Tabubrüche tatsächlich sind.
Wenn etwas Ungeheuerliches geschehen ist, dann treten bald schon Ungeheuer auf den Plan. Als würde die Welt selbst darum ringen, in den Zustand der ›vormaligen Harmonie‹ wieder zurückzukehren. — Aber irgendwie muß das Vergehen gesühnt werden. Es muß erst wieder aus der Welt geschafft werden durch Buße, weil erst dann die ›heilige Ordnung‹ wieder hergestellt werden kann.
Zugleich sind die Götter selbst im Prozeß der Theogenese. Eine Götterdynastie folgt auf die nächste. — Interessant sind die Reflektionen darüber. So hat Kronos durch fortgesetzte Kindstötung der Gaia vorenthalten, was Mütter wollen, die Kinder aufwachsen sehen.
Der Mythos schildert in dieser Vorstufe einen Zustand, in dem nicht wirklich Entwicklung statthaben konnte. — Erst in der Ära von Zeus wird die Welt auf die Menschheit zentriert. Dann treten die glücklichen Götter Athens sogar freiwillig zurück, um im Zuge des Prometheus–Projektes der Menschheit die Welt zu überlassen.
Die Entstehung des Gewissens
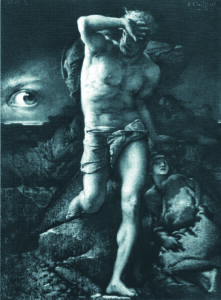
François Chifflart: Das Gewissen. 1877, Maisons de Victor Hugo, Paris. — Quelle: Public Domain via Wikimedia. Es ist vermutlich der aus Ägypten durch den Tempelpriester Moses beim Auszug der Juden mit auf den Exodus genommene monotheistische Gott, der bereits bei den Ägyptern mit einem allsehenden Auge symbolisiert wurde. Auch die Idee vom Jenseitsgericht stammt aus Ägypten, was zur bemerkenswerten Tradition der Ägyptischen Totenbücher geführt hat, das Leben als Vorbereitung auf den Tod zu betrachten.
Mit der Bedrohung durch das Jüngste Gericht des Lebens kommt eine Psychogenese in Gang, die eine systematische Selbstbeobachtung erforderlich macht. — Wenn ein allgegenwärtiger und allwissender Gott ohnehin alles ›sieht‹, so daß man ihm nichts verbergen kann, dann scheint es angeraten zu sein, sich ein Gewissen zuzulegen, um sich genau zu beobachten und ggf. zu kontrollieren.
Dementsprechend ist Kain auf der Flucht vor dem ›allsehenden Auge‹, weil er ›vergessen‹ hat, sich beizeiten ein Gewissen zu ›machen‹. — Das ist aber nur eine, noch dazu weniger anspruchsvolle Deutung des vermeintlichen Brudermords. Aus Gründen der Ethnologie können Ackerbauern und Hirten keine ›Brüder‹ sein. Offenbar hat sich der hier verehrte Gott, der das Opfer des Bauern ›ablehnt‹, noch nicht damit arrangiert, daß die Tieropfer seltener und die Opfer von Getreide und Früchten zunehmen werden.
Kain auf der Flucht
Erst mit der Urbanisierung erhält der Prozeß der Zivilisation seine entscheidende Dynamik. Der alles entscheidende Impuls geht mit dieser Gottesidee einher, mit der ganz allmählich aufkommenden Vorstellung eines Gottes, der alles ›sieht‹. — Dementsprechend illustriert Fernand Cormon die Flucht des Kain unmittelbar nach der Tat. Das Werk ist durch Victor Hugo inspiriert und schildert die Szene auf groteske Weise.
Der Plot selbst ist zutiefst paradox: Kain ist Bauer. Er lebt von den Früchten der Erde, fürchtet sich jedoch schrecklich vor dem neuen transzendenten Gott, der im Himmel über den Wolken schwebt und der alles ›sieht‹. — Er verliert im Opferwettstreit, erschlägt seinen Kontrahenten, ist aber von diesem missionarischen Hirten offenbar längst bekehrt worden, denn er fürchtet sich fortan wie wahnsinnig vor diesem Gott. Darauf beginnt er eine halsbrecherische Flucht, um sich dem allsehenden, allwissenden, allgegenwärtigen Auge dieses Gottes doch noch zu entziehen.

Fernand Cormon: Kain. 1880, Musèe d’Orsay, Paris. — Quelle: Public Domain via Wikimedia. -
Anthropologie, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Kunst, Moderne, Platon, Psyche, Religion, Seele, Utopie, Wahrheit, Wissenschaftlichkeit, Zivilisation
Psyche und Seele
Über Unterschiede, die wieder das Ganze in den Blick nehmen
Man glaubt, die Naturwissenschaften an die Stelle der Kirche setzen zu können und “alles” ist gut. Wissenschaft kann aber Religion gar nicht ersetzen. Außerdem gehörten dann auch die Geisteswissenschaften dazu.
Da man dann aber selbst denken und sich bilden müßte, bleibt man lieber auf der “sicheren” Seite, bei “den” Fakten und verpaßt letztlich alles, was Wert wäre, gelebt, empfunden, gefeiert, geliebt und sogar geheiligt zu werden.
Die Naturwissenschaften haben die Welt nur entzaubert und eine leere Welt geschaffen, in der dann ein nihilistischer Naturalismus die Leute erschreckt. Wichtig wäre, daß Naturwissenschaftler nicht über Sachen reden, für die sie nicht zuständig sind. – Wie Juri Gagarin, der erste Kosmonaut, der getreu seiner Partei verlautbaren ließ. Er wäre nach ein paar Erdumrundungen nun schon ziemlich weit im Kosmos herumgekommen, Gott habe er jedoch nicht gesehen. – Heilige Einfalt!
Es gibt nicht nur Materie, sondern auch Geist, und wie man sieht, auch die Disziplin der Geistlosigkeit. – Es gibt nicht nur naturwissenschaftliche Fakten, sondern auch Narrative. Das ist übrigens das, was in anderen Kulturen als der “Geist der Ahnen” bezeichnet wird. Es sind die Narrative, in denen dieser “Geist” aufbewahrt wird, so daß man ihn jederzeit zu Rate ziehen kann, in den alten Geschichten.
Es gibt nicht nur Körper und Psyche, sondern auch Leib und Seele. Und dann gibt es auch noch den Geist.
Vor allem der Unterschied zwischen Psyche und Seele hat es mir in letzter Zeit angetan. Um die Corona-Krise überhaupt noch verstehen zu können, habe ich gute alte Begriffe wieder reaktiviert, so daß ich sie nun aktiv verwende. Es sind die Begriffe “Leib, Seele” und “Geist”.
Ich vermute nämlich, daß die Psyche wohl eher ein Teil unseres Maskenspiel ist. Sie ist also nicht so authentisch, wie wir glauben.
Die Psyche ist eher wie das “schlechte Pferd” in Platons Seelenwagen. – Wenn diese Hypothese stimmt, dann wäre die Psyche ein Teil der “Maske”, wie wir sie tragen, um uns selbst und anderen etwas vorzumachen.
Während die Psyche viel Wert legt auf Äußerlichkeiten, ob die Inszenierung stimmt und den Vorbildern aus maßgeblichen Filmszenen “gerecht” werden kann. Legt die Seele, wenn man wiederum Platon folgt, großen Wert auf das, was der Psyche oft nur nachgesagt wird, echte Gefühle, wirkliche Verbundenheit, wahre Authentizität, tiefes Verstehen.
Das ist alles nicht schlimm sondern völlig in Ordnung: Wir brauchen alles, Mechanik, Materie, Naturwissenschaften, Fakten, Narrative, Psyche, Seele und Geist. – Man sollte nur eben immer auch wenigstens ahnen, worauf es jeweils ankommen könnte, auf welcher Ebene ein Phänomen angesprochen werden muß.
Wenn man in diesen Angelegenheiten etwas besser unterscheiden möchte, dann empfehle ich Platon. – Es ist berückend, wenn er im “Phaidros” erklärt, was mit der Seele ist.
Das wird einmal veranschaulicht durch einen Seelenwagen, der von zwei Pferden gezogen und von einem Wagenlenker geführten wird. Dabei wird die Bedeutung von Schönheit und Liebe für die Seele und deren Wiedergeburt zur Darstellung gebracht.
Einmal in tausend Jahren brechen die Götter zum Triumphzug über das Firmament, über die Milchstraße, auf, um bis an die Grenzen dieser Welt vorzudringen, um im Jenseits vom Jenseits die Ideen zu schauen. Mit dabei sind auch Menschen, die aber Mühe und Not haben, gewisse, schwierige Himmelspassagen zu meistern, mit einem guten und einem schlechten Pferd. – Das ist der Plot.
Ich habe schon oft darüber philosophiert, geschrieben und Vorträge gehalten, aber das Original ist eben Platon. – Es ist schön zu sehen, was er gesehen hat.
-
Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Moderne, Moral, Motive der Mythen, Theorien der Kultur, Utopie, Zeitgeist, Zivilisation
Demut schützt vor Hybris
Hochmut kommt vor dem Fall
Es ist mehr als nur eine Geste der Bescheidenheit, es ist auch eine Verneigung, wenn man konstatiert, bei aller Größe sei man selbst nun auch nicht voraussetzungslos. — Wie irre muß man eigentlich sein, das als Demütigung zu empfinden. Tatsächlich geht es um die Würde der Gesellschaft.
Ähnlich irre meinen ja auch Vertreter der Wirtschaft, daß sie der Gesellschaft von Nutzen sei, einfach weil sie Geschäfte macht, um dabei die Infrastruktur, die Bildung, das Rechtsystem und die Infrastruktur einfach kostenlos zu nutzen. Wieso soll man sich denn an den Voraussetzungen beteiligen?
Das ist auch die wirklich gemeingefährliche Vision der Superreichen, die offenbar dabei sind, genau diese Dystopie wirklich werden zu lassen. — Die Gated community, die geschlossenen und bewachten Wohnanlagen, in denen Privatrecht herrscht, sind bereits das erste Zeichen dieser unheilvollen Entwicklung. Dort gibt es ja schon Privatpolizei, wie wäre es denn mit einem eigenen Rechtssystem?
Es ist ein Gebot von Demut und Bescheidenheit, generell anzuerkennen, daß das, was man ist, kann und geleistet hat, ob Gewinn oder Verlust, Sieg oder Niederlage, im Zweifelsfall den Göttern oder sonstigen höheren Mächten zu verdanken ist. Wo das nicht geschieht, dort wird es immer gefährlicher, denn dann kommt Hybris auf. Das ist nicht nur Hochmut, sondern Dummheit, weil man sich und die eigenen Kompetenzen dabei ganz erheblich überschätzt. Natürlich muß es dann zu Katastrophen kommen.
Die Demutsformel von den „Voraussetzungen, die man selbst nicht geschaffen hat“, muß wirklich von Herzen kommen. Denn dann versteht man sich als das, was man ist, ein ziemlich kleines Teil eines reichlich großen Ganzen, das man nicht nur nicht in der Hand hat, sondern zumeist nicht einmal versteht. Ich empfehle zunächst eine Roßkur mit Luhmann–Lektüre gerade für Weltverbesserer, wie ich selbst einer bin. Und darüber hinaus muß auf jeden Fall sehr viel mehr Philosophie in die öffentlichen Debatten, denn es ist einfach ganz schrecklich, was da so tagein tagaus an Böcken geschossen wird. Als würde neuerdings mangelndes Denken belohnt.
Es besteht die Gefahr, daß man mit dem besten Willen und noch besseren Absichten ganz schlimmes Unheil anrichten kann. — Daher hat man die Gewaltenteilung erfunden und den Monotheismus auf der Ebene von Staatstheorie und Rechtsphilosophie schon seit langem überwunden. Nur, daß die Leute es nicht verstehen, weil sie größtenteils noch in Märchenwelten leben. Immerzu wird gequatscht, wie im Kindergarten, es sollten für alle dieselben Regeln herrschen, das müsse doch alles zentralistisch, aus einem Guß, ohne Ausnahmen, selbstverständlich mit hartem, härtestem, ach, drakonischen Maßnahmen. Seufz. — Nein!
Das Gegenteil ist richtig. Auch Schwarmintelligenz braucht erst einmal Zeit, sich zu entwickeln und eine gute Pädagogik, die Gelegenheiten schafft, daß sie sich auch entfalten kann.
Was tut man, das Gegenteil. Jetzt soll auch noch telegram verboten werden, so wie es den totalitären Staaten nun auch nicht gefällt, daß die Leute einfach so, also unkontrolliert miteinander reden. Sorry, geht es noch?
Das Gegenzeit ist richtig! Es soll eine argwöhnische und eifersüchtige Feindschaft zwischen den staatlichen Gewalten herrschen! Es soll, darf und kann nicht alles in einer Hand liegen. – Diese Lektion sollten alle aus der Geschichte längst bezogen haben.
Wieso kommt das Gesundheitsamt in Mainz dieser Tage einer Bitte der Polizei nach und simuliert einen Infektionsfall, um an Daten der Luca-App zu kommen, um eine Straftat aufzuklären? Ich habe meine Teilnahme nunmehr deinstalliert. — Wer „pragmatisch“ wird, ist nur ein Mensch ohne Prinzipien und sollte gar nicht in Staatsdienste übernommen werden. Wo zum Pragmatismus aufgefordert wird, wollen Leute pfuschen und nur das. Warum, weil sie die Demutsformel nicht beherrschen.
Das Leben ist komplizierter und auch das Verhältnis zwischen Staat, Gesellschaft, Gemeinschaft und Identität ist es. Es ist einfach grober Unfug, wenn so getan wird, Gesellschaft und Staat, das alles sei dasselbe. Nein, ist es überhaupt nicht! – Im Prozeß der Zivilisation haben Könige kleine Häuptlingstümer unterworfen und in Gesellschaften gezwungen. So sind die ersten Staaten entstanden.
Staaten sind in diesem Sinne noch immer die Unterdrücker ganzer Gesellschaften und die Unterjocher von Gemeinschaften, die dann als Minderheiten tituliert und darüber hinaus verunglimpft und entmenschlicht werden. Das sieht man allenthalben aber nun auch immer unverblümter im angeblich freien Westen. Im Westen galt bisher noch ein gewisser Stil.
Der Staat lebt nicht für, sondern von der Gesellschaft, ebenso wie die Wirtschaft. Sie ist die Kuh, die alle besitzen, melken und am liebsten schlachten würden.
Im wohlverstandenen eigenen Interesse ist jedoch wärmstens zu empfehlen, sich die Demutsformel zu Herzen zu nehmen. Denn ein Parasit ohne Wirt sieht alt aus. Es wäre viel klüger, wenn der Parasit zum Symbionten wird. Genau das steckt ja auch hinter der Gewaltenteilung. Und dieses Theater wird auch schon häufig inszeniert. Es kommt aber noch immer nicht von Herzen.
Die uralte Brutalität, die übrigens erst mit der Zivilisation in die Welt gekommen ist, schlägt noch immer durch. — Daher nun mal kein historischer Vergleich, sondern eine Allegorie.
Der Staat ist ein Schläger, immer schon, ein brutaler Ausbeuter und nicht eben ein Freund der Gesellschaft, sondern ihr Unterdrücker, eigentlich ihr Zuhälter. Natürlich ist diesem am Wohlergehen seiner „Liebste“ gelegen. — Aber wie macht man daraus allmählich ein ausgewogenes Verhältnis?
Wie oft ist es allein in den letzten 200 Jahren dazu gekommen, daß der Staat die Gesellschaft mißbraucht, geschändet, verkauft, geschädigt, ausgebeutet, erniedrigt und auf den falschen Weg geführt hat? Heraus aus dem Glück und der Hochkultur in der Aufbruchstimmung um 1900, hinein in den Krieg. Warum? Weil eine „Élite“ keine Demokratisierung wollte. — Moderne ja, aber nur nach militaristischer Manier, später dann als Faschismus. Man will die Vorzüge, aber nicht die Nachtteile, nämlich „mehr Demokratie“ wagen.
„Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit, und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.“ (Perikles, um 500 – 429 v. Chr., athenischer Politiker und Feldherr, Quelle: Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges.)
Genau das spielte sich damals ab im alten Athen, als die Griechen sich gegen die übermächtigen Perser wehren mußten. Sogar das Orakel von Delphi lag falsch. Natürlich war es unwahrscheinlich, daß die Griechen das durchstünden. Aber es gab da einen Mann namens Perikles, ein begnadetet Stratege und Rhetor, der dafür sorgte, daß der gemeine Mann auf eigene Kosten mit in den Krieg zog und nicht nur der Adel, der ja im Zweifelsfalle doch ein wenig schwach ist, wenn es wirklich darauf ankommt.
Aber und das ist der Gag: Also forderte der gemeine Mann dann aber auch bei der Herrschaft im Staat mitzuwirken. So entstand die erste Demokratie, in der nicht in Ämter gewählt wurde, sondern sie wurden verlost und es war Pflicht, dem nachzukommen. Man sollte vielleicht wieder das Los entscheiden lassen, dann hätte das Glück wenigstens eine Chance.
Das Bundesverfassungsgericht trägt den größten Teil der Verantwortung für den Niedergang der Demokratie in der Corona–Krise, für die Spaltung der Gesellschaft und dafür, daß die Politik inzwischen über Hecken und Zäune geht. Es wäre an der Zeit gewesen, die Demutsformel in Erinnerung zu rufen und zu konstatieren, daß der Zweck die Mittel nicht heiligen kann, wenn es gegen Grundgesetze geht und einfach alles, was heilig ist.

Franz von Stuck: Dissonanz (1910). Hätte das nicht mehr ehrenwerte Gericht doch die Politik in Grenzen verwiesen. Das hätte die Politik entlastet, denn sie hätte immer sagen können, es seien ihr nun mal die Hände gebunden. Sie könne nur und müssen daher mehr Eigenverantwortung wagen, der Staat wäre darauf angewiesen, daß die Gesellschaft ihm Voraussetzungen schafft, die er nicht herbeizwingen kann.
Schön wäre es gewesen, wir hätten dann eine Zivilgesellschaft mit Achtung vor dem Gesetz und der Gesellschaft und vor Andersdenkenden bekommen. Wir hätten eine Solidargemeinschaft, die heute nur noch angeführt wird, um Druck gegen Andersdenkende zu erzeugen. Wir hätten den Schritt vom Obrigkeitsstaat in die Zivilgesellschaft geschafft, das wäre nach 1989 so etwas gewesen wie eine Metamorphose. Aus der häßlichen Raupe der Deutschen wäre ein Schmetterling geworden…
Klingt das zu naiv, nun, naiv sind vor allem die Moralisten dieser Tage, denn sie geben vor, alles abzuwägen, dabei sind sie nur Denkverweigerer. Und so fragt man sich: Was ist schlimmer, Querdenken oder Nichtdenken?
-
Anthropologie, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Identität und Individualismus, Kunst, Künstler, Moral, Professionalität, Theorien der Kultur, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation
Berühren verboten!
Aber Gedanken sind frei
Der Verlust an Nähe ist das eigentliche Problem. Ein Eisberg, von man die Tiefen nur ahnen kann.
Seit Ischgl wissen wir, es kommt auf die Viruslast an. Man infiziert sich kaum im Vorbeigehen, auf die Gefahren der Nähe kommt es an.
Kultur ist am Feuer entstanden. Vorne wird man gut angebraten und von hinten friert es. Also rückt man noch näher aneinander und reibt sich gegenseitig den Rücken. Und dazu werden berauschende Substanzen gereicht. Man starrt wie hypnotisiert ins Feuer, öffnet sich dem Anderen, dann wird erzählt…
So sind die ersten Geschichten der Menschheit ausgetauscht worden. Und während man da so sitzt, kreisen drumherum die Ungeheuer. Wohlige Schauer laufen über den Rücken. Das ist Geborgenheit.
Und dann steckt man die Köpfe zusammen. Wie oft saßen wir nächtelang schwitzend beieinander. Im Nebel aller erdenklicher Körperausdünstungen. — Menschen sind Säugetiere, sie machen sehr viel mit der Nase. Auch die Wahl von Partnern und Freunden geht über den Geruch.
Aber jetzt traut man sich nicht einmal mehr, die Nasenflügel zu blähen. Es liegt womöglich Corona in der Luft. Also besser nicht allzu tief und frei atmen. Als wäre Nähe inzwischen nur noch etwas für Lebensmüde.

John Collier: Circe (1885). Was der Verlust an Nähe mit den Menschen macht, dürfte ebenso gefährlich sein, wie die Ängste, die Kinder in den Suizid treiben. Wie soll man Kindern, Dementen und Sterbenden erklären, daß Nähe gefährlich geworden ist.
Es ist, wie eine Umprogrammierung. Man soll Nähe zulassen, sich berühren lassen, empathisch sein, andere auch gern einfach umarmen, weil es mehr ist als eine Geste, es ist ein Bekenntnis der Mitmenschlichkeit. — Und jetzt?
Das ist wohl der Grund, warum der Haß immer größer wird.
Berühren verboten! Nähe ist verdächtig geworden.
Kultur ist Nähe, also gefährlich. Denken sowieso.
Aber Philosophie findet im Kopf statt. Die Gedanken sind frei.
-
Anthropologie, Ausnahmezustand, Corona, Corona-Diskurs, Corona-Politik, Diskurs, Ironie, Moderne, Moral, Motive der Mythen, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Wissenschaftlichkeit, Zeitgeist, Zivilisation
Verstehen
Über Sacha Lobos „Denkpest“
und die Steingärten des Denkens
Hannah Arendt stellte sich im Interview mit Günther Gaus vor mit dem Satz: „Ich will verstehen!“ Das spricht mir aus dem Herzen. — Ich muß, was ich verstehen will, überhaupt nicht teilen und derselben Meinung sein. Ich muß es nur nachvollziehen können, denn Verstehen ist eine Art Mit–Sein. Nicht–Verstehen, Unverständnis, Falschverstehen, Mißverstehen, das alles ist problematisch und gewissermaßen unphilosophisch.
Sollten wir nämlich auf falscher Grundlage zu einem Urteil oder zu einer Reaktion gelangen, ist das alles natürlich auch falsch. Wir hätten dann ja rein gar nichts verstanden, glaubten aber dennoch, darüber auch noch abschließend urteilen zu können. — Die Kunst des Zuschauers verlangt daher, ohne Ansicht der Person, der Partei und auch ohne Ansehen der eigenen Vorurteile möglichst alles in Betracht zu ziehen.
In der Denkpraxis ist das binäre Kodieren, wonach alles entweder ganz wahr oder ganz falsch ist, natürlich völlig naiv. Es gibt immer irgendein Fünkchen Wahrheit und sei es noch so klein.
Ein Wort von Sacha Lobo dieser Tage läßt tief durchblicken und erahnen, wie militant Parteilichkeit praktiziert wird. Er spricht allen Ernstes von der „Denkpest“ dieser Tage. Er meint wohl, andere sollen nicht so viel nachdenken, es sei denn, man dächte das Denken der Vorbeter, wie er einer ist. — Denken ist aber nun mal kein Nachbeten.
Ich habe mehrfach in meinem Buch ernsthafte Versuche unternommen, den Gipfel der Verschwörungstheorien zu erklimmen, den QAnon-Mythos. Der Mega–Plot hat was, denn wir leben ja angeblich darin.
Das ist ja alles auch spannend: Also, in der Nähe des einzig wahren Präsidenten Trump soll sich ein gewisser Herr Q aufhalten, der wie ein guter Geist diesem gescheitesten aller Präsidenten dabei helfen soll, den „Deep State“, den Sumpf einer verschworenen Élite und das ganze Machtkartell ihrer Privilegien auszutrocknen. — Anweisung von der Regie: Bitte nicht darauf achten, daß Trump doch selbst einer von denen ist…
Generalanweisung der Regie: Generell bitte nicht zu sehr auf Widersprüche und vor allem nicht auf Selbstwidersprüche achten. Auch das Ockhams Rasiermesser, also das Prinzip der Denkökonomie, darf vorerst nicht zum Einsatz kommen! — Es gibt eine ganze Reihe philosophischer Methoden, die bei diesem Selbstversuch nicht zum Einsatz kommen dürfen, will man den Gipfel dieser Verschwörung erklimmen.
Die Kunst des Zuschauers macht es erforderlich, jede beliebige Perspektive einnehmen zu können, also auch solche. Es ist allerdings abenteuerlich, dort überhaupt hinzugelangen. Am besten versorgt man sich gleich zu Beginn dieses Weges mit passenden Allegorien. Zum Beispiel wirkt der Weg, um auf den Berg dieser Verschwörung zu kommen, eher märchenhaft. Es scheint, als wäre es eine verrückte Welt, besser noch, als wäre es nicht wirklich diese Welt, sondern eine mit sehr viel Phantasie und Absurditäten.
Das fiel mir auf, als ich heute einen Artikel las über diesen QAnon–Schamanen beim Sturm auf das Kapitol. Ich habe sodann versucht, mir — aus seiner Perspektive — seine Motive zu eigenen zu machen, ohne sie zu teilen. Ich will einfach nur verstehen, wie man ticken muß, um wie er zu sein.
Es sei kein Angriff auf dieses Land gewesen, das sei nicht sein Motiv, sagte Jake Angeli dem US-Sender CBS News in seinem ersten Interview nach seiner Verhaftung. „Ich habe ein Lied gesungen, das ist Teil des Schamanismus. Es geht darum, positive Energie in einer heiligen Kammer zu erzeugen“. Seine Absicht sei es gewesen, „Gott zurück in den Senat zu bringen“. Deswegen habe er dort „ein Gebet gesprochen.“ — Nun das klingt subjektiv glaubwürdig.
Er wußte also, daß er einen Ort mit großer Bedeutung doch eigentlich als Unberufener einfach so besetzt und damit doch vielleicht eher selbst entweiht hat. — Ich hätte nicht übel Lust auf einen Disput mit ihm genau darüber.
Übrigens kommen jetzt gewiß bei einigen Nicht–Facklern und Durchgreifern die üblichen Formulierungen auf wie: „Spielt doch keine Rolle, was er sich dabei gedacht hat. Ab ins Gefängnis und Schluß mit der Debatte!“
Vorsicht, das Bild dieses singenden QAnon–Schamanen ist zur Ikone geworden, vielleicht auch, weil es das schlechte Gewissen bedient, den indianischen Ureinwohnern gegenüber. Diese Bildikone ist in aller Köpfe und wirkt, auch auf die stolzen Besitzer von Steingärten des Denkens, in denen garantiert nichts mehr wächst.
Aber genau darum geht es doch eigentlich: Gedanken anzuzüchten wie in der Infektiologie, um zu sehen, was sie eigentlich für welche sind. Und natürlich treffen auch Philosophen ihre Schutzmaßnahmen. — Ich muß zugeben, daß das Verstehen-Wollen manchmal etwas zu viel wird. Mir ist mehrfach wie bei einem kollossalen Systemfehler das ganze Denken zusammengebrochen. Ratsam wäre es, wenigstens nicht auch noch an den Ästen sägen, auf denen man gerade sitzt.
Nun macht das Verschwörungsdenken ja deswegen so große Probleme, weil man es „nachwollziehen“ will, um es aus seiner Perspektive zu verstehen, weil aber immerzu behauptet wird, das alles sei wirklich wirklich wirklich. Also das mit der Pizzeria, in deren Keller kleine Kinder verkauft werden, das mit der Schuppenhaut von “Bill Gates”, den ich in seiner Rolle als angemaßter Weltgesundheitsminister völlig inakzeptabel finde, das mit dem “Deep State” oder auch das mit dem “Great Reset”, also dem „Menschenaustausch“.
Alle diese Theoreme bringen denkerisch ganz erhebliche Belastungen mit sich, es sind Attacken, die schnell zur Systemüberlastung führen, so daß zusammenbrechen muß, was eigentlich obligatorisch wäre. Das macht die Gespräche mit aktiven Verschwörungstheorie–Anhängern so schwierig, weil man schnell konfus wird darüber, daß sie von eins aufs andere kommen. Alles hängt mit allem zusammen, gewiß, nur sieht man es auch beim besten Willen nicht.
Mein Lieblingssatz aus der Ethologie lautet folgendermaßen: Der Schamane Katka sieht auf einem Baum eine Hexe. Ich sehe, wie Katka die Hexe sieht, sehe aber selbst die Hexe nicht. — Nun damit sollte man schon klarkommen, als Ethnologe und auch als Philosoph.
Mit dem hypothetischen Für-Wahr-Halten ist das so eine Sache. Da irren die Steingarten-Besitzer nicht. Und die Denkpest von Sacha Lobo fordert tatsächlich ihre Opfer, wenn man denn keine Methoden hat und noch dazu die Hosen voll. Es könnte sich ja irgendwas Ungeheuerliches als wahr herausstellen und was dann? Daher die Steingärten, in denen gleich gar nichts wächst.
Aber ich habe mich nie damit zufriedengegeben, nur über Verschwörungstheorie zu reden und mich darüber billig zu amüsieren. Ich habe es mehrfach und immer wieder anders versucht, obwohl so ein Breakdown ziemlich viel kostet. Es dauert, bis man danach einigermaßen auf der Höhe ist und sich wieder selbst über den Weg trauen kann, von wegen: All Systems Running.
Ich hatte bereits bei vorangegangenen Untersuchungen feststellen können, daß manche der Ereignisse, von denen in den Verschwörungs–Theoremen gesprochen wird, tatsächlich in der Menschheitsgeschichte vorgekommen sind, wie etwas der “Menschen–Austausch”, etwa mehrfach durch die Pest oder auch durch die Sintflut, also den Einbruch des Schwarzen Meeres, was inzwischen nachweisbar geworden ist.
Mit der Hypothese, daß wir das alles präsent haben im kollektiven Unbewußten, läßt sich dann auch nachvollziehen, warum diese Horrorvorstellungen präsenter erscheinen als sie es sind. — Das ist dann auch der entscheidende Aspekt, daß so etwas stattfinden kann und auch bereits geschehen ist, daß man aber — jetzt kommt Ockhams Rasiermesser doch zum Einsatz — nicht ohne weiteres behaupten darf, daß beispielsweise jetzt der “Great Reset” wieder unmittelbar bevorstünde.
Man macht diese Behauptung gern fest anhand eines Appells von Klaus Schwab, dem Leiter des Bonzenfestivals in Davos, genannt Weltwirtschaftsforum. Auch da läßt sich die Perspektive durchaus übernehmen. Es ist vom „Great Reset“ die Rede, weil es um die menschengemachte Welt ökologisch, ökonomisch und politisch überhaupt nicht gutsteht. Es braucht in der Tat einen Kurswechsel, ein Update, einen Reboot, um die Metapher voll zur Geltung zu bringen. — Aber nun anzunehmen, es käme dabei auf einen Gen–Austausch etc. an, ist reichlich bei den Haaren herbeigezogen und bedürfte daher eigens einer hinreichenden Begründung, warum das denn doch gelten soll, warum diese Behauptung glaubhaft sein soll.
So weit so gut. Das genügt mir aber noch nicht, denn es ist noch nicht hinreichend für das Verstehen. Bis ich heute darauf kam, wie man auch und ganz bewußt mit Verschwörungstheorien umgehen könnte.
Es sind Träume. Daher haben sie alle Rechte von Träumen und so gut wie keine Pflichten. Denn Träume machen ja nun wirklich, was sie wollen. Und dabei regen wir uns auch nicht darüber auf, daß sie wirr sind, unrealistisch, blödsinnig und sonstwie für den hemdsärmeligen Intellekt einfach ein Ärgernis, weil er nicht weiß, wie und wo er anpacken soll.
Anders geht damit jedoch unser Geist um, über den wir auch verfügen sollten, falls wir keine stolzen Steingarten–Besitzer sind und auch nicht Sacha Lobo heißen. Der Geist kann mitunter Träume deuten, und das ist die Lösung des Problems. Es sind „Träume“, zumeist Horrorträume, oft ohne Sinn und Botschaft aber auch das ist ja nun etwas, das wir den Träumen zugestehen müssen. Wir sollten die Zeichen darin sehen und erkennen, um ihnen die Bedeutung zuzugestehen, wie wir sie manchmal auch Träumen geben, wenn sie uns etwas zu Verstehen geben, zumeist auf symbolischer Ebene.
Am Ende kommt es darauf an, was der Zuschauer im Rücken des Zuschauers sieht. Was er glaubt, ganz allmählich verstehen und dann sogar auch in eigenen Worten vertreten zu können. Das ist dann wiederum der Abstieg aus den massiven Gebirgen unserer Phantasien, die wer weiß wo in den unendlichen Weiten unseres Unbewußten zu besuchen sind, denn dort sind sie in der Tat „real“.
Es liegt an den Grenzen der Sprache, denn zumeist fehlen einfach die Worte. Und im übrigen regelt die Grammatik das Privileg der Phänomene generell, ob sie für die Wirklichkeit überhaupt in Frage kommen. Wir können aber nun unser Denken nicht erweitern, wenn wir uns von der Grammatik das Denkmögliche vorbeten lassen. — Die deutsche Sprache hat einige Entwicklungen noch nicht genommen. Sie verfügt über keinen Irrealis als eigenständigen Modus, jedoch über das Konzept.
Der Konjunktiv II kann dazu benutzt werden, einen Irrealis der Gegenwart und einen Irrealis der Vergangenheit zu bilden, der als irreales bzw. unerfüllbares Konditionalgefüge erscheint:
Wenn ich gedanklich reich wäre, also keinen Steingarten des Denkens hätte und auch nicht Sacha Lobo hieße, böten sich mir mehr Möglichkeiten des Verstehens. (Irrealis der Gegenwart, mit Konjunktiv II)
-
Anthropologie, Ausnahmezustand, Diskurs, Ethik, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Ironie, Kunst, Künstler, Moderne, Moral, Motive der Mythen, Professionalität, Religion, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Zeitgeist, Zivilisation
Georg Stefan Troller zum Hundertsten
Sich auf das Verstehen verstehen
Er hat mich geprägt, denn er zeigt immer wieder, wie Verstehen möglich ist und wie fantastisch es sein kann. Dabei ist sein Verständnis oft etwas mutwillig hergeholt, aber genau damit wird er zum Vorbild.
Ja, man kann verstehen, muß sich aber nicht gleichmachen. Aber vielleicht war und ist es ja auch “nur” die Sonne in seinem Herzen und das bei diesem Lebensweg, – vielleicht auch gerade deswegen.
Dieses Niveau ist einmalig. Der freundliche, leicht ironische Unterton, das stets bereitwillige Understatement, das zur Not auch betont hemdsärmelig daherkommt, von wegen, es müsse doch wohl so sein… — Das ist höchste Kunst der Begegnung. Dabei kommt alles so leichtsinnig und flaneurhaft daher, aber es werden Tiefen erreicht, die oft nicht einmal erahnt werden.Es ist schon bestechend, dabei zu sein, um mitzuerleben, wie leicht man auf wirklich Wichtiges kommt ohne diese stromlinienförmige Oberflächlichkeit, die nur so tut, als wäre da Tiefe. — Dann dieser Ton mit einer verlockenden Komplizenschaft für den Zuschauer, der mit ihm gern auf Erkundung. Man vertraut sich gern an.Da weiß einer sehr viel zu erzählen und versteht sich auf das Verstehen und das auch noch in grotesken Begegnungen. Man spürt, wie eine Zeit auf die andere folgt im Sauseschritt. — Stets sind es bereichernde Begegnungen und Erfahrungen, die sogleich ein Teil werden, als hätte man es selbst erlebt.Troller tut das, was die Mythen immer schon wollten: Weltvertrauen schaffen auf der Grundlage eines Understatements, das es sich leisten kann, sich zu riskieren.Herzlichen Glückwunsch, Georg Stefan Troller! -
Anthropologie, Corona, Corona-Diskurs, Diskurs, Götter und Gefühle, Identität und Individualismus, Kunst, Künstler, Moderne, Motive der Mythen, Religion, Theorien der Kultur, Urbanisierung der Seele, Utopie, Zeitgeist, Zivilisation
Kunst, Künstler und Gesellschaft
Video: Anmerkungen zum Projekt Hawerkamp
Seit 1988/89 hat sich auf dem ehemaligen Gewerbegelände „Am Hawerkamp“ in Münster mit städtischer Duldung bzw. Unterstützung ein „Kulturgelände“ entwickelt. Dort finden sich Ateliers für Künstler, Clubs, Bühnen, Werkstätten und Initiativen.
Der Videokünstler Jürgen Hille hat mit „Projekt Hawerkamp“ im Frühsommer 2021 an diesem Ort mit einer Reihe von Interviews und Filmszenen auf seine Weise eine „Realitätsforschung“ betrieben, um den Geist des Ortes zu charakterisieren.
Meine „Philosophische Ambulanz“ findet sich in Sichtweite, wenige Projekte, wie etwa mein „Public Writing“ haben ich auch schon dort inszeniert. — Also wurde ich zum Interview gebeten. Dabei nahm ich die Gelegenheit wahr, einmal das Verhältnis zwischen Kunst, Künstlertum und Gesellschaft zur Sprache zu bringen.
Jürgen Hille: Realitätsforschung, 2021.
Der Ursprung von Kunst hat immer etwas Sakrales. Sie dient dem Ausdruck einer Schönheit, hinter der etwas Heiliges steht. — Im Hintergrund steht der wiederkehrende Wunsch nach Begegnungen mit dem Heiligen. In dieser Tradition, in diesen Diensten stehen die Künste von Anfang an.
Je weiter der Prozeß der Zivilisation voranschreitet, umso weiter kommt es zur Entzauberung der Welt. Umso mehr brauchen wir die Künste, weil sie etwas bewahren, was Zivilisationsmenschen aufgeben, weil es jenseits der Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis liegt.
Insofern sind Künstler ganz besondere, nicht selten eigenartige Menschen, die gern über den Zaun schauen. Insofern ist es die Aufgabe von Kunstwerken, daß sich Geheimnisse aufdecken. — Auf diese besonderen Begegnungen mit dem Geheimnisvollen kommt es an. Daher sind solche Soziotope von immenser Bedeutung.
Aber unserer Gesellschaft fehlt inzwischen bereits sehr viel mehr. Eine Welt, die nur auf Geld aus ist und glaubt, sich Seelenheil erkaufen zu können durch Selbstinszenierungen, die ohne Herz und Seele sind, ist kaum mehr zu retten und eigentlich auch nicht der Rettung wert. — Was die Kunst als Arbeits- und Lebenswelt vor Augen führt, ist das gerade Gegenteil der Aufspaltung in Lebenswelt und Arbeitswelt, in Leben und Gegenleben.
Die Arbeits– und Lebenswelten sind offenbar nur erträglich, wenn es immer wieder „Urlaub“ von alledem gibt. Nur ist diese Trennung selbst das Problem. Wir haben Lebenskonzepte, die eigentlich gar nicht zum Leben da sind, sondern dazu, daß wir arbeiten und konsumieren sollen. — Daher ist es so schön, daß es Künstler gibt, die einfach von diesen vorgefertigten Lebenswegen abweichen, die das Ihre tun und der Gesellschaft vorführen, was alles anders sein kann.