In eigener Sache: Der Zuschauer des Zuschauers
Schreiben ist mehr als nur eine Tätigkeit, sondern vielmehr eine Haltung…

Heinz–Ulrich Nennen: Philosophie in Echtzeit: Der Corona–Diskurs als Katharsis. Panik, Absturz, Krise und Transformation. (ZeitGeister4); Hamburg 2020.
Vieles, was tagtäglich so dahergeredet wird, käme geschrieben kaum noch zur Sprache. Daher rühren die gewaltigen Unterschiede zwischen dem, was sich spüren, fühlen, denken, sagen, schreiben oder sogar erläutern läßt. – Jede Aussage hat immer auch einen Standpunkt, der zumeist aber gar nicht erst thematisiert wird, genau darauf käme es aber an.
Philosophie in Echtzeit bedeutet, den Versuch zu unternehmen, einen Diskurs, einen Skandal oder eben auch die Corona-Krise zu deuten, noch während sie sich soeben ereignet. – Das ist ein gewagtes Unternehmen, hängt doch wie ein Damoklesschwert dabei der Spruch des Boethius über dem Kopf des Philosophen: „Und hättest Du geschwiegen, wärst Du Philosoph geblieben”.
Es kommt bei Boethius allerdings nicht nur auf das Gesagte an, sondern auch darauf, ob dem Anspruch auf Philosophie gerecht geworden wird. Bei ihm war es vor allem auch der Habitus einer stoisch-christlichen Duldsamkeit, die von vielen Denkern dieser Epoche empfohlen wurde. Moderne Zeiten geben dagegen andere Bedingungen vor und bieten Möglichkeiten, etwa im Diskurs mit vielen anderen wissenschaftlichen Disziplinen auf sehr viel mehr Wissen zurückgreifen zu können. Aber auch das ist heikel, weil die Relevanz einer Erkenntnis sehr häufig nicht angemessen beurteilt wird.

Richard Westall: English: The Sword of Damocles. 1812 (painting), 2008-01-20 (photograph). Ackland Museum, USA.
Die Wissenschaften insgesamt machen ein eher diskursives Vorgehen möglich und erlauben, ganz im Sinne der Vernunft, die Einheit der Welt in der Vielfalt ihrer Perspektiven systematisch zu erforschen. Alte, sehr ehrenwerte Vorstellungen vom Götterhimmel kehren dabei wieder zurück. So wie das Pantheon wirklich aller Götter gedacht war, so sollten wir, wenn wir Philosophie betreiben, gleichfalls alle Perspektiven sichten. – Das wäre Vernunft, eben durch Multiperspektivität, daher kommt es auf die Kunst des Zuschauers an, auf Perspektivismus und darauf, das Denken selbst zu bedenken und in der Schwebe zu halten.
Das aktuelle Projekt einer „Philosophie in Echtzeit” ist dem Corona-Diskurs gewidmet. Es gilt, darüber spekulieren zu können, was darauf folgen wird. Daher ist es erforderlich, zunächst einmal nachvollziehen und verstehen zu können, wie es eigentlich zum Shut-Down hatte kommen können. – Auch dazu gab es wieder einmal keine Alternative, was prinzipiell bezweifelt werden muß.
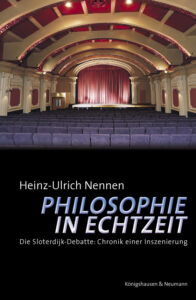
Heinz-Ulrich Nennen: Philosophie in Echtzeit. Die Sloterdijk-Debatte: Chronik einer Inszenierung. Über Metaphernfolgenabschätzung, die Kunst des Zuschauers und die Pathologie der Diskurse. Würzburg 2003.
Hier geht es aber nicht darum, im nachhinein gewußt haben zu wollen, was besser gewesen sein würde. Es ist eine Situation ohne Beispiel entstanden, daher sollten wir uns ruhig etwas schwertun mit Erklärungen und Deutungen. Auch gilt es zu bedenken, was mit diesem wochenlangen Ausnahmezustand selbst wiederum einhergegangen sein wird.
Das alles wird eine Rolle spielen, wenn wir vorgreifen, um darüber zu spekulieren, welche Welt danach zu wünschen, zu erwarten oder auch zu befürchten sein wird. Die Zukunft ist offen, inzwischen wird bereits von Zukunft im Plural gesprochen, von Zukünften. Es gibt also gleich mehrere davon.
Die Latenzen und Tendenzen sind aber in den Prozessen, die von der Vergangenheit über die Gegenwart bis hin zu einer Zukunft führen, mitunter bereits angelegt. Vieles läßt sich vorhersehen, vieles aber ist auch noch offen. Es gilt, den Geist nach Corona jetzt schon zu deuten.
Das Glück muß beim Schopfe gepackt werden, was aber nur gelingt, wenn es soeben vorbeizieht in einem glücklichen Augenblick. Die Allegorie für den Kairos hat lange Locken, die aber nur vor dem Gesicht hängen, hinten ist Fortuna kahl. Wenn sie vorbeigezogen ist, wird die Gelegenheit vertan worden sein. – Es gilt also, den Diskurs über die kommende Zeit zu eröffnen: In welcher Welt wollen wir leben?
Und so handelt es sich in diesem Projekt um ein weiteres Stück Experimentalphilosophie einer Philosophie in Echtzeit. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, den Standpunkt der Betrachtung immer wieder zu wechseln. Erst alle erdenklichen Perspektiven, erst alle wissenschaftlichen Disziplinen, erst alle Hinsichten erlauben es, ganz allmählich einen kritischen Diskurs zu etablieren, der sich aus dem Panikmodus heraushebt.

Kairos auf einem Fresko von Francesco Salviati im Audienzsaal des Palazzo Sacchetti in Rom, 1552/54.
„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold!”, so lautet eine weitere Warnungstafel. Bei aller Häme gegen ungedachte Nachdenklichkeit, steckt dahinter eine nicht unberechtigte Erwartung: Was auch immer gesagt wird, Philosophie sollte nicht einfach nur daneben liegen. Wird in ihrem Namen das Wort ergriffen, dann ist damit bereits ein Anspruch auf Relevanz und Geltung erhoben worden.
Es sollte also zu erwarten sein, daß Beschreibungen, Auffassungen, Deutungen und Einlassungen sich als angemessen, berechtigt, begründbar, ja sogar als wohlbegründet erweisen. Aussagen mit dem Anspruch auf Philosophie sollten nachhaltig sein, sie sollten sich so schnell nicht von der Wirklichkeit einholen oder gar überholen lassen. Auch kann es nicht darum gehen, die Sache selbst aus den Augen zu verlieren und einfach nur zu dozieren, was nebenher von Belang sein mag aber mit der Sache selbst kaum noch etwas zu tun hat. Kurzum, die Sache selbst sollte deutlicher werden.
Philosophie zu betreiben bedeutet daher nicht nur, den Sachen auf die Spur zu kommen, sondern auch, sich selbst dabei zu beobachten. Also kommen unbequeme Fragen auf wie diese: Warum legen wir eigentlich eine bestimmte Weise der Wahrnehmung an den Tag, warum keine andere? Warum konstruieren wir unsere Wirklichkeiten in bestimmten Situationen nun einmal so und nicht anders? – Dagegen ist es sehr bequem, eine jeweils gegebene Auffassung einfach als alternativlos hinzustellen.
Alle unsere Auffassungen von Wirklichkeit beruhen auf Konstruktionen, also auf Anschauungen, die auch anders ausfallen könnten. Wir sollten daher nicht nur die Sache, sondern auch uns selbst mit ins Kalkül ziehen. Der Betrachter ist stets Teil der Betrachtung, daher ist es so wesentlich, das eigene Zuschauer-Sein selbst noch einmal eigens zu betrachten und mit in Erwägung zu ziehen. Philosophie geht daher nicht darin auf, nur Wissenschaft oder nur Philosophiegeschichte zu sein. Es geht immer auch um die Kunst, neue und vielleicht sogar ungewohnte Perspektiven systematisch zu erschließen, um sie sodann miteinander abzustimmen, vielleicht auch gegeneinander auszuspielen, so daß sich Dialoge oder auch Diskurse ergeben, die auf dem Weg zu den Sachen sukzessive weiterkommen sollten.
Beim Philosophieren geht es zwar um Theorie, aber zugleich ist es eine Praxis, in der sich größere Zusammenhänge aber auch verschwiegene Hintergründe zeigen. Ideal wäre es, die Sachen selbst zur Sprache, wenn möglich zum Reden zu bringen und dabei ist es wesentlich, genauer einschätzen zu können, was überhaupt gesagt, worüber dagegen (noch) ganz bewußt geschwiegen werden sollte. Es geht daher gar nicht um die Alternative, entweder zu reden oder aber zu schweigen. – Die eigentliche Differenz zwischen Reden und Schweigen ist viel subtiler, denn sie ist abhängig vom Stand der Untersuchung, von der Vollzähligkeit der unterschiedlichen Perspektiven, von den Lücken in der Wahrnehmung und nicht zuletzt auch vom Ausdrucksvermögen unserer Sprache.
Also geht es immer auch um Methode, um das systematische Aufschließen neuer und ungewohnter Perspektiven, um ein möglichst behutsames Vorgehen bei der Bewertung dessen, was beim jeweiligen Stand der Untersuchungen bereits gesagt werden kann und was dagegen noch offen gehalten werden muß. – Denken ist ein Prozeß, der sich erst ereignen muß, der dann aber auch in Echtzeit betrieben werden kann, soweit die Worte tragen.
Wir sind zumeist nicht auf Augenhöhe mit dem Zeitgeist, echte Dialoge und tatsächliche Diskurse finden oftmals gar nicht statt, weil dazu die nötige Contenance fehlt. Wenn überhaupt, dann wird nur mit Gleichgesinnten debattiert und dann auch nur in Hinsicht auf ein „Wir”, die wir doch nicht so, wie die anderen sind. Es wird zu wenig und wenn, dann nicht richtig debattiert. Zumeist wird nicht problemzentriert sondern lösungsorientiert argumentiert. Wer bereits die Lösung hat, also nur noch verkaufen will, wird gute aber doch nur subjektive Gründe haben, davon überzeugt zu sein. Wer glaubt, die Lösung bereits zu haben, wird gar nicht problemorientiert denken wollen, weil das ja nun aufhalten würde, zu seiner Lösung, Religion oder Wahrheit zu kommen.
Wer problemorientiert vorgeht, ist schweigsamer, schon gar nicht polternd und laut. Das kann als Schwäche ausgelegt werden. Also demonstrieren gewisse Politiker, daß sie anpacken und durchgreifen können. Dabei wird dann die Härte und Konsequenz bei der Durchsetzung der Maßnahmen und die starre Haltung, gar nicht mehr mit sich reden zu lassen, doch tatsächlich von vielen als Führungsstärke empfunden. Dabei ist es einfach nur die Inszenierung eines Habitus, um zu imponieren.
Viele lassen sich blenden, weil ihnen schwebendes Denken wie alles, was in der Schwebe ist, so ganz und gar nicht behagt. Viele werden die Offenheit, die vielen Möglichkeiten, die Grundsatzdiskussionen der kommenden Zeit unerträglich finden. – Aber so viel kann jetzt bereits gesagt werden, der Zeitgeist in der Welt vor Corona wird ein anderer gewesen sein. Es gilt, herauszubringen, was denn in der Welt nach Cora anders sein wird, vielleicht auch anders sein könnte und sollte.

